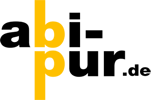Wahrheitsverständnis - das Wahrheitsverständnis im Glauben, in der Wissenschaft und im Journalismus
Schlagwörter:
Höhlengleichnis, Wissenschaftliche Beschreibung der menschlichen Wahrnehmung, Konstruktivismus, Christentum, Medienethik, Referat, Hausaufgabe, Wahrheitsverständnis - das Wahrheitsverständnis im Glauben, in der Wissenschaft und im Journalismus
Themengleiche Dokumente anzeigen
Höhlengleichnis, Wissenschaftliche Beschreibung der menschlichen Wahrnehmung, Konstruktivismus, Christentum, Medienethik, Referat, Hausaufgabe, Wahrheitsverständnis - das Wahrheitsverständnis im Glauben, in der Wissenschaft und im Journalismus
Themengleiche Dokumente anzeigen
Referat
Das Wahrheitsverständnis im Glauben, in der Wissenschaft und im Journalismus
Gliederung / Inhalt
- Höhlengleichnis
- Wissenschaftliche Beschreibung der menschlichen Wahrnehmung
- Verständnis und Grenzen der Naturwissenschaft von Wirklichkeit
- Konstruktivismus
- Wissenschaft vs. Glauben
- Wahrheitsverständnis im Christentum
- Medienethik
Höhlengleichnis
- Abbild der Wahrheit
- Gefangene waren in einer Höhle, die eine Mauer davor hatte und wo auf der anderen Seite der Mauer ein Weg und in einiger Ferne ein Feuer
- über die Mauer hinweg zeigten Leute verschiedene Gegenstände, die die Gefangenen im Schatten an der Wand durch das Feuer sehen konnten
- die Leute durften nicht miteinander reden und hielten somit verschiedene Sachen für die Schatten
- dieses Gleichnis zeigt, dass der erste Eindruck trügen kann und dass der Mensch mit seiner begrenzten Wahrnehmung durch Aktionen, wie andere Leute zu fragen, die sich auskennen, oder an die Mauer zu gehen, um zu schauen, was dort ist, seine begrenzte Wahrnehmung ausweiten kann
- Parallele zu Konstruktivismus: man kennt nur die Illusionen, die man mit Erfahrung begründen kann
- Unterschied zu Konstruktivismus: einer macht sich von den Fesseln frei und erkennt die Wahrheit ↔ es gibt mehrere Wahrheiten
- um die Wahrheit zu erkennen, muss man erst von den sinnlichen Wahrnehmungen weggehen
- Wahrheit täuscht und, wir müssen dahinter gelangen → Erkenntnis bekommen (über das Intellektuelle)
→ Tiere können das nicht, nur der Mensch kann Erkenntnis erreichen - wir sehen nur Schatten von den Dingen (sehen es nur begrenzt)
[zurück zum Inhaltsverzeichnis]
Wissenschaftliche Beschreibung der menschlichen Wahrnehmung
- Grundlagen der Neurowissenschaft
- psychisch/mentale Vorgänge (Prozesse) basieren auf biologischen/biochemischen Vorgängen
- diese sind durch neuronale „Sprache“ beschreibbar
- „Gedanken/Gefühle sind alles biologische Vorgänge“ (neuronal)
- Gehirn ist der Verarbeiter von Informationen/Reizen von außen und nicht der Wahrnehmer, welche er einordnet
- jedes Gehirn produziert seine eigene Vorstellung von außen
- das Gehirn als Akteur bringt die „Wirklichkeit“ hervor
- Gehirn vergleicht und bildet daraus die Wahrheit
- es konstruiert sich „seine“ Welt
- menschliche Wahrnehmung geschieht als Prozess der Verarbeitung von Reizen → nicht willkürlich, sondern gezielt
- bei der menschlichen Wahrnehmung spielen immer schon emotionale Bewertungen hinein
- das limbische System (Gefühle) kann man nicht ausschalten → Emotionen spielen immer eine Rolle
- Kritik an der Neurowissenschaft
- können nicht alles, was wir denken, auf das Gehirn zurückführen → Mensch interagiert mit der Umwelt (= der Mensch denkt, nicht das Gehirn)
[zurück zum Inhaltsverzeichnis]
Verständnis und Grenzen der Naturwissenschaft von Wirklichkeit
- Voraussetzung
- spezifische Untersuchungsobjekte
- spezifische Verfahrensweise
- Verfahrensweise
- Aufdecken von Gesetzmäßigkeiten (in Form von Naturgesetzen)
- beobachtende Analyse und Erklären, d.h. Angabe von Gesetzmäßigkeiten und Mechanismen, die das Auftreten von Phänomenen begreifbar und somit voraussagbar machen (messbar durch Messinstrumente)
- Grenzen
- bewusstseins(un)abhängige Realität
- von menschlichem Denken (un)abhängige Wahrheit → „der“ Mensch ist der Erfinder und Entwickler von Messinstrumenten und -methoden → Auswertung geschieht in seiner Lebenswelt
[zurück zum Inhaltsverzeichnis]
Konstruktivismus
- Erkenntnistheorie
- will menschliche Wahrheit erklären (sehr eingeschränkte, subjektive, individuelle Wahrnehmung → nicht zur maximalen/genauen Wirklichkeitswahrnehmung)
- Basis: Gehirn, Neurobiologie
- menschliches Gehirn ist ein geschlossenes, in sich selbst organisiertes, informationsverarbeitendes „System“
- Struktur ist die gleiche, aber da jeder Mensch anders gestrickt ist, erhält jeder eine andere Wahrheit (passt in das Weltbild der einzelnen Menschen hinein)
- jeder baut sich selbst seine Wahrnehmung aus Erfahrungen
- das Gehirn kriegt „Rohmaterialien“ (Informationen der Außenwelt) und verarbeitet, interpretiert und versteht diese auf eine bestimmte Weise (z.B. Musik = Musikeindruck - Schallwellen)
- man sucht such seine Wirklichkeit, die in den Kontext passt/was er schon kennt (Mensch will nur das wahrnehmen, was auch in die Strukturen hineinpasst → will nicht immer auf neues reagieren/sich an neues gewöhnen → „Mensch ist ein Gewohnheitstier“, weil alles andere permanenter Stress wäre)
- zwei Gehirne können die gleiche Wahrheit zu einer Sache haben
- man hat Strukturen im Gehirn, die auf eine bestimmte Weise arbeiten
- Gehirn hat eine Art System (wie Computer), das in sich geschlossen ist
- Konstruktivismus, weil das Gehirn sich seine eigene Welt/Wahrheit konstruiert → nicht eine umfassende Wahrheit
- man kann nicht sagen, was falsch und was richtig ist, sondern nur wie das Gehirn arbeitet
- Gegenteil zu Platon (dass man die eine Wahrheit erkennen kann)
- „Denken muss sich der Sprache bedienen.“
- man muss, um denken zu können, die Gedanken in Worte fassen können
- nicht individuell (wenn man Gedanken mit anderen teilen will)
- Probleme des Konstruktivismus:
- man konstruiert sich seine Wirklichkeit nicht komplett individuell, weil man seine Gedanken ausdrücken muss und man mit anderen Leuten kommuniziert und so seine Wirklichkeit ändern und anpassen kann
- Sprache ist nicht individuell und setzt Sozialität voraus
- man denkt an sich individuell, aber man denkt durch die Wörter, die man benutzt, insofern nicht mehr individuell (mit Bildern schon)
- mein Gehirn muss das Gesagte erneut interpretieren, wenn jemand anderes dir zum Beispiel seine Wahrheit erzählt, muss mein eigenes Gehirn diese erst wieder verarbeiten, wodurch sie schon verändert werden kann
- Interpretation = strukturierende Arbeit des Gehirns (durch Hirnforschung bestätigt)
- Lernen = kein passives Aufnehmen und Abspeichern von Informationen
- → aktiver Prozess der Wissenskonstruktion, selbst gesteuerter Prozess
[zurück zum Inhaltsverzeichnis]
Wissenschaft vs. Glauben
- Wissenschaft
- will Vermutungen beweisen (man beobachtet etwas und schaut, ob man es beweisen kann oder nicht)
- es gibt immer einen Restzweifel
- Glauben
- Behauptung
- soll nicht (natur-)wissenschaftlich bewiesen werden können
[zurück zum Inhaltsverzeichnis]
Wahrheitsverständnis im Christentum
- 1. Kor 13
„Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin.“- Wahrheit: bruchstückhaft und dunkel
- was bleibt: Glaube, Hoffnung, Vertrauen
- Joh 14,6
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ - der christliche Glaube und sein Wissen bieten keine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zur Erklärung der Welt
- er orientiert die Welt auf einen Realismus aus der Perspektive der Geschichte Gottes → christlicher Glaube ist nicht ein defizienter (unvollständiger/unzulässiger) Modus des Erkennens, sondern die Beziehung zum Wissen und Erkennen auf Gottes Wirken (Erbarmen) in Jesus Christus
- Jesus ist der Orientierungspunkt
- personales Verständnis → in ihm muss man die Wahrheit erkennen (Personenbezogen)
- Wahrheit bezieht sich auf Jesus, man soll sich nach ihm richten
- Wahrheit wird geglaubt (Vertrauen), in der Wissenschaft wird sie bewiesen
- es geht um Glauben und Vertrauen und nicht um Beweisen
- der Weg ist die Wahrheit
- die ganze Wahrheit kann man (in dieser Welt) nicht haben
[zurück zum Inhaltsverzeichnis]
Medienethik
- nicht die ganze Wahrheit
- Journalist ist subjektiv, somit auch der Artikel
- geht an eine Sache ran, weil er sie berichten will → entscheidet sich aktiv dazu
- Berichterstattung erfolgt nach gewählter Zensur
- man schreibt Zeitungen/Zeitschriften, um sie zu verkaufen → Verlage sind auf Profit aus
- wir selbst konsumieren bewusst die subjektiven Medien
- ist eine objektive Berichterstattung überhaupt möglich?
- Faktoren, wie ein Journalist die Wahrheit verzerrt
- Subjektive Berichterstattung (ist alles eher subjektiv damit es spannender ist, weil er seine Leser emotional packen will)
- Berichterstattung auf der Basis von bewusster Selektion (Was will man darstellen? Wen will man ansprechen?)
- sucht aus (muss z.B. ein Interview auf die wesentlichen Aussagen reduzieren)
- Verkürzung (sucht aus, was für ihn wichtig ist und Zensur)
→ nur Auszug des Geschehens - Bilder und Texte sind nur Momentaufnahmen
- Medien sind narrativ (z.B. Menschen werden gut oder schlecht dargestellt)
- Sprache als mediale Präsenzform
- mit Sprache wird sehr viel beeinflusst
- Zeitdruck und Konkurrenz: schnelle Berichterstattung, um als erster über ein Thema berichten zu können → manche Informationen fehlen
- überspitzte/reißerische Überschriften
- Artikel müssen eine Pointe haben
- möglichst wenig Geld ausgeben, aber möglichst viel verkaufen
- Grundregeln für eine möglichst objektive Darstellung der Wahrheit
- faktenbasiertes Berichten (keine eigene Meinung)
- gute und wissenschaftliche Recherche
- förmliche Sprache benutzen, wenn etwas nicht im Gegenspruch zu unserem Weltbild steht, Autorität bestätigen, großer Aufwand betrieben wird
- Journalist muss Rechenschaft über sein Handeln abgeben (dass er subjektiv schreibt)
- Verschiedene Blickwinkel
- Wie schreibt man möglichst wahrheitsgemäße Berichte?
- wahrheitsgetreu die Informationen wiedergeben
- keine Quellenbearbeitung/Angabe der Quelle
- Abgleichung von verschiedenen Artikeln, um die Wahrheit zu finden
- sachliche, wissenschaftliche Sprache
- Experten
- viel Aufwand in der Recherche
Folgende Referate könnten Dich ebenfalls interessieren:
Die nachfolgenden Dokumente passen thematisch zu dem von Dir aufgerufenen Referat:
Freie Ausbildungsplätze in Deiner Region
besuche unsere Stellenbörse und finde mit uns Deinen Ausbildungsplatz
erfahre mehr und bewirb Dich direkt
Suchen
Durchsucht die Hausaufgaben Datenbank