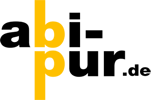Gomorra von Maria Janitschek
1 |
Das Feuer schleicht in den Gassen |
2 |
Mit leisem Raubtiertritt, |
3 |
Die schönen Töchter, die blassen, |
4 |
Vernehmen nicht seinen Schritt. |
|
|
5 |
Sie ruhn auf weichen Fellen, |
6 |
Müde von Tanz und Gelag, |
7 |
Ihre jungen Brüste schwellen |
8 |
Entgegen dem morgigen Tag. |
|
|
9 |
Sie träumen von dunklen Freuden, |
10 |
Von heimlicher Harfen Klang, |
11 |
Von königlichem vergeuden |
12 |
Und lachendem Überschwang. |
|
|
13 |
Sie träumen von dunklen Freuden, |
14 |
Von heimlicher Harfen Klang, |
15 |
Von königlichem Vergeuden |
16 |
Und lachendem Überschwang. |
|
|
17 |
Sie träumen von Cherubsflügeln |
18 |
Da stoßen die Wächter ins Horn, |
19 |
Not über Gassen und Hügeln |
20 |
Lodert Jehovas Zorn. |
Details zum Gedicht „Gomorra“
Maria Janitschek
5
20
84
1859 - 1927
Realismus,
Naturalismus,
Moderne
Gedicht-Analyse
Das Gedicht „Gomorra“ stammt von der österreichischen Schriftstellerin Maria Janitschek, die von 1859 bis 1927 lebte. Sie war eine Vertreterin der literarischen Bewegung des Naturalismus, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland und Österreich verbreitete.
Auf den ersten Blick wirkt das Gedicht recht düster und gespenstisch. Bereits in der ersten Strophe bemerkt man eine Spannung, die sich durch das ganze Gedicht zieht. Es wird von Feuer gesprochen, das in den Gassen umherschleicht und droht, Unheil anzurichten.
Inhaltlich handelt das Gedicht von den Bewohnern der biblischen Stadt Gomorra, die im Alten Testament als Ort moralischer Verderbtheit dargestellt wird. Das lyrische Ich beschreibt die Bewohner als sorglos, die sich in Dekadenz und hedonistischer Lebensweise verlieren. Sie sind sich der drohenden Gefahr, symbolisiert durch das Feuer, nicht bewusst oder ignorieren diese bewusst.
Die Form des Gedichtes ist streng strukturiert mit jeweils vier Versen pro Strophe. Wiederholungen und Parallelismen in den Versen tragen dazu bei, eine Atmosphäre von bedrohlicher Eintönigkeit und unausweichlichem Schicksal zu erzeugen. Die Sprache ist bildhaft und enthält viele Metaphern und Symbole, wie zum Beispiel das Feuer, das Raubtier und die Harfenklänge.
Insgesamt spiegelt das Gedicht eine tiefe moralische Warnung wider. Es kritisiert eine Gesellschaft, die sich in Überfluss und Unmoral verliert, ohne die Konsequenzen ihres Handelns zu bedenken. Gleichzeitig kann es auch als ein Aufruf gesehen werden, wachsam zu sein und die Zeichen der Zeit zu erkennen, bevor es zu spät ist. Der Titel „Gomorra“ unterstreicht diese Interpretation, da er sich auf eine Bibelgeschichte bezieht, in der die Stadt wegen ihrer Sündhaftigkeit von Gott zerstört wird.
Weitere Informationen
Maria Janitschek ist die Autorin des Gedichtes „Gomorra“. 1859 wurde Janitschek in Mödling bei Wien geboren. Zwischen den Jahren 1875 und 1927 ist das Gedicht entstanden. Anhand der Entstehungszeit des Gedichtes bzw. von den Lebensdaten der Autorin her kann der Text den Epochen Realismus, Naturalismus, Moderne, Expressionismus, Avantgarde / Dadaismus oder Literatur der Weimarer Republik / Neue Sachlichkeit zugeordnet werden. Prüfe bitte vor Verwendung die Angaben zur Epoche auf Richtigkeit. Die Zuordnung der Epochen ist auf zeitlicher Ebene geschehen. Da sich Literaturepochen zeitlich überschneiden, ist eine reine zeitliche Zuordnung häufig mit Fehlern behaftet. Das vorliegende Gedicht umfasst 84 Wörter. Es baut sich aus 5 Strophen auf und besteht aus 20 Versen. Die Dichterin Maria Janitschek ist auch die Autorin für Gedichte wie „Triumph“, „Mädchenfrage“ und „Der Sterbende“. Auf abi-pur.de liegen zur Autorin des Gedichtes „Gomorra“ keine weiteren Gedichte vor.
+ Wie analysiere ich ein Gedicht?

Weitere Gedichte des Autors Maria Janitschek (Infos zum Autor)
Freie Ausbildungsplätze in Deiner Region
besuche unsere Stellenbörse und finde mit uns Deinen Ausbildungsplatz
erfahre mehr und bewirb Dich direkt