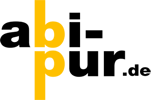Goethe, Johann Wolfgang - Ein Gleiches Wanderers Nachtlied (Gedichtinterpretation)
Johann Wolfgang Goethe, Wanderers Nachtlied, Analyse, Formanalyse, Inhaltsangabe, Interpretation, Referat, Hausaufgabe, Goethe, Johann Wolfgang - Ein Gleiches Wanderers Nachtlied (Gedichtinterpretation)
Themengleiche Dokumente anzeigen
ein gleiches analyse, interpretation ein gleiches goethe, ein gleiches interpretation, interpretation wandrers nachtlied tod, gedichtinterpretation wanderers nachtlied
Referat
Gedichtinterpretation: „Ein Gleiches“ (1780, Johann Wolfgang Goethe)
Das Gedicht ist auch unter dem Titel „Wanderers Nachtlied“ bekannt und Goethe schrieb es ein zweites Mal, wodurch der Titel „Ein Gleiches“ entstand. Es wurde zwar 1780 verfasst, jedoch erst 1815 veröffentlicht.
Ein gleiches
von Johann Wolfgang von Goethe
1 |
Ueber allen Gipfeln |
2 |
Ist Ruh’, |
3 |
In allen Wipfeln |
4 |
Spürest du |
5 |
Kaum einen Hauch; |
6 |
Die Vögelein schweigen im Walde. |
7 |
Warte nur, balde |
8 |
Ruhest du auch. |
(„Ein gleiches“ von Johann Wolfgang von Goethe ist auch in unserer Gedichtedatenbank zu finden. Dort findest Du auch weitere Gedichte des Autoren. Für die Analyse des Gedichtes bieten wir ein Arbeitsblatt als PDF (23.5 KB) zur Unterstützung an.)
Formanalyse
- eine Strophe mit acht Versen
- Reimschema: Kreuzreim
- bis zum vierten Vers wechseln Trochäus und Jambus von Vers zu Vers
- ab Vers fünf: freie Rhythmik
- Inversion („In allen Wipfeln spürest du“)
- Hyperbel („Über allen Gipfeln…“, „In allen Wipfeln…“)
- metaphorische Sprache (s. Vers eins und zwei)
- Ansprache des Lesers (s. Vers vier, sieben und acht)
Johann Wolfgang Goethes Gedicht „Ein Gleiches“, besser bekannt als Wanderers Nachtlied, ist eines der bekanntesten Werke der deutschen Literatur. Es wurde im Jahr 1780 verfasst, jedoch erst 1815 veröffentlicht. Der Titel „Ein Gleiches“ entstand durch die zweite Niederschrift des Gedichts, die Goethe einem früheren Gedicht mit ähnlichem Titel gegenüberstellte.
Das Werk umfasst acht Verse in einer einzigen Strophe. Es folgt einem Kreuzreim und wechselt in den ersten vier Versen zwischen trochäischem und jambischem Metrum, bevor es in eine freie Rhythmik übergeht. Sprachlich ist das Gedicht geprägt von Inversionen, wie in „In allen Wipfeln spürest du“, sowie Hyperbeln und metaphorischen Bildern, die den Text zu einem tiefsinnigen Natur- und Lebensgedicht machen. Besonders auffällig ist die direkte Ansprache des Lesers, die das Gedicht persönlich und eindringlich wirken lässt.
Inhalt
- Vers eins: Verweis auf die Ferne und Weite des Himmels
- Vers drei: Abdeckung der Pflanzenwelt
- Vers sieben und acht: Bezug zum Menschen
- „Abwärtsbewegung“ vom Himmel zum Menschen
Goethe beginnt mit einer Beschreibung der Natur: „Über allen Gipfeln ist Ruh.“ Hier eröffnet er den Blick in die Ferne, die Gipfel als Sinnbild für Erhabenheit und Transzendenz. Mit „In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch“ wird die Perspektive nach unten auf die Pflanzenwelt gelenkt, die in die Stille der Nacht eingebettet ist. Die Bewegung setzt sich fort, bis sie den Menschen erreicht, auf den sich die letzten beiden Verse beziehen: „Warte nur, balde ruhest du auch.“ Diese „Abwärtsbewegung“ symbolisiert eine Verbindung zwischen Himmel, Erde und Mensch und suggeriert eine universelle Einheit in der Ruhe der Natur.
Interpretation
- zentrales Motiv: der Tod (Ausdruck durch den Begriff „Ruhe“)
- das Gedicht ist kein reines Naturgedicht, denn die Tatsache, dass Vögel schweigen, ist befremdlich
- Vers sieben und acht: der sehnsüchtige Wunsch nach einem sanften Tod im Einklang mit der Ruhe und dem Frieden der Natur
- Leser wird angesprochen und in das Geschehen eingebunden
- Der Tod wird nicht negativ und bedrohlich, sondern als Erlösung gesehen
- durch die Einbindung aller anderen Naturelemente (Wipfel, Vögel) wird eine friedliche, harmonische Stimmung hervorgerufen, die dem Tod seine bedrohliche Wirkung nimmt
Das zentrale Motiv des Gedichts ist die „Ruhe“, die hier als Metapher für den Tod dient. Goethe schafft es, den Tod nicht als etwas Bedrohliches oder Negatives darzustellen, sondern als einen sanften Übergang, eingebettet in die friedvolle Stille der Natur. Die schweigenden Vögel im Wald verstärken die Atmosphäre der Ruhe, erzeugen aber auch ein leicht befremdliches Gefühl, das auf die Endgültigkeit des Todes verweist.
Die direkte Ansprache des Lesers in den letzten Versen, „Warte nur, balde ruhest du auch“, bindet den Leser in das Geschehen ein und vermittelt die unausweichliche Endlichkeit des Lebens. Gleichzeitig wird die Idee eines Todes im Einklang mit der Natur zu einer Sehnsucht nach Frieden und Erlösung, weg von den Mühen des Lebens.
Die Harmonie und Stille, die durch die Beschreibungen der Gipfel, Wipfel und Vögel erzeugt wird, nehmen dem Tod seine Bedrohlichkeit und verleihen ihm stattdessen eine sanfte, beruhigende Wirkung. Goethe schafft es, die Natur in ihrer Gesamtheit einzubinden, um den Tod als etwas Natürliches darzustellen, das weder Angst macht noch Unruhe stiftet.
„Ein Gleiches“ ist mehr als ein Naturgedicht. Es ist ein tiefsinniges Werk über den Tod und die Harmonie, die in der Natur und im Leben liegt. Goethe vermittelt, dass der Tod nicht als Ende, sondern als Teil eines größeren Kreislaufs verstanden werden kann – friedvoll, harmonisch und eingebettet in die Stille der Welt.
Folgende Referate könnten Dich ebenfalls interessieren:
Die nachfolgenden Dokumente passen thematisch zu dem von Dir aufgerufenen Referat:
- Goethe, Johann Wolfgang von - Wanderers Nachtlied (kurze Gedichtanalyse)
- Goethe, Johann Wolfgang von - Wanderers Nachtlied (Gedichtinterpretation)
- Goethe, Johann Wolfgang von - Neue Liebe, neues Leben (Gedichtanalyse)
- Goethe, Johann Wolfgang von - Willkommen und Abschied (Interpretation der späteren Fassung)
- Goethe, Johann Wolfgang von - Vor dem Tor (Faust 1, Szeneninterpretation)
Freie Ausbildungsplätze in Deiner Region
besuche unsere Stellenbörse und finde mit uns Deinen Ausbildungsplatz
erfahre mehr und bewirb Dich direkt