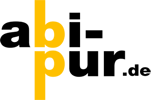Eichendorff, Joseph von - Die zwei Gesellen (umfangreiche Gedichtanalyse)
Joseph von Eichendorff, Analyse, Interpretation, Romantik, Gedichtinterpretation, Gedichtanalyse, Frühlingsfahrt, Referat, Hausaufgabe, Eichendorff, Joseph von - Die zwei Gesellen (umfangreiche Gedichtanalyse)
Themengleiche Dokumente anzeigen
Referat
„Die zwei Gesellen“ von Joseph Eichendorff (Analyse und Interpretation)
Die zwei Gesellen
von Joseph von Eichendorff
1 |
Es zogen zwei rüst'ge Gesellen |
2 |
Zum erstenmal von Haus, |
3 |
So jubelnd recht in die hellen, |
4 |
Klingenden, singenden Wellen |
5 |
Des vollen Frühlings hinaus. |
|
|
6 |
Die strebten nach hohen Dingen, |
7 |
Die wollten, trotz Lust und Schmerz, |
8 |
Was Rechts in der Welt vollbringen, |
9 |
Und wem sie vorübergingen, |
10 |
Dem lachten Sinnen und Herz. |
|
|
11 |
Der erste, der fand ein Liebchen, |
12 |
Die Schwieger kauft' Hof und Haus; |
13 |
Der wiegte gar bald ein Bübchen, |
14 |
Und sah aus heimlichem Stübchen |
15 |
Behaglich ins Feld hinaus. |
|
|
16 |
Dem zweiten sangen und logen |
17 |
Die tausend Stimmen im Grund, |
18 |
Verlockend' Sirenen, und zogen |
19 |
Ihn in der buhlenden Wogen |
20 |
Farbig klingenden Schlund. |
|
|
21 |
Und wie er auftaucht' vom Schlunde, |
22 |
Da war er müde und alt, |
23 |
Sein Schifflein das lag im Grunde, |
24 |
So still war's rings in die Runde, |
25 |
Und über die Wasser weht's kalt. |
|
|
26 |
Es singen und klingen die Wellen |
27 |
Des Frühlings wohl über mir; |
28 |
Und seh ich so kecke Gesellen, |
29 |
Die Tränen im Auge mir schwellen |
30 |
Ach Gott, führ uns liebreich zu dir! |
(„Die zwei Gesellen“ von Joseph von Eichendorff ist auch in unserer Gedichtedatenbank zu finden. Dort findest Du auch weitere Gedichte des Autoren. Für die Analyse des Gedichtes bieten wir ein Arbeitsblatt als PDF (25.9 KB) zur Unterstützung an.)
Das Gedicht „Die zwei Gesellen“ (oder auch „Frühlingsfahrt“)von Joseph Eichendorff wurde im Jahr 1818 veröffentlicht und handelt von dem Wandern zweier Gesellen, der Trennung ihrer Wege und ihrem jeweiligen Einzelschicksal, wozu das lyrische Ich am Ende des Gedichts Stellung bezieht. Das Gedicht thematisiert die verschiedenen unterbewussten Entscheidungen, die das Leben einzigartig gestalten. Das Gedicht lässt sich der Epoche der Romantik zuordnen, welche stark durch die Motive Natur, Religion, Sehnsucht und Mystik geprägt ist.
Formal betrachtet besteht das romantische Gedicht aus sechs Strophen zu je fünf Versen. Es lässt sich ein erweiterter umarmender Reim feststellen, da sich je der erste Vers auf den dritten und vierten reimt, sowie der zweite Vers auf den letzten (vgl. V. 1 ff.). Das Gedicht weist das Reimschema abaab auf, wobei es auf a immer weibliche Kadenzen gibt und auf b männliche. Dadurch überwiegen die weiblichen Kadenzen mit dem Verhältnis 3:2. Das Metrum ist nicht einheitlich, sondern variiert zwischen Jambus und Daktylus. Es ist außerdem kein regelmäßiges Metrum, sowie keine regelmäßigen Kadenzen vorhanden, weshalb das Gedicht eine eher aufregende und universelle Wirkung erzeugt (vgl. V. 1 ff.). Hinzufügen lässt sich, dass jede Strophe aus einem Enjambement besteht (vgl. V. 1 ff., 6 ff.), dies bricht die gängige Struktur des Gedichts, sodass dieses flüssiger klingt.
Die erste Strophe beschreibt, wie zwei junge Männer mit positiven Emotionen in die Welt hinausziehen. Die zweite Strophe beschreibt die hohen Ziele der Männer, welche sie mit großer Freude nacheifern. Die dritte Strophe geht auf den Lebenslauf des ersten Mannes ein, welcher eine Frau findet, in ein Haus zieht und eine Familie gründet. Das Leben des zweiten Mannes wird in Strophe vier und fünf beschrieben. Dieser wird von den Eindrücken des Lebens verführt, bis er schließlich alt und müde nach einem unglücklichen Leben stirbt. Die sechste und letzte Strophe geht wieder auf das Leben des ersten Mannes ein, welcher zwar ein glückliches Leben gelebt hat, allerdings nun auch gerne in den Himmel überwechseln würde.
Die beiden ersten Strophen können dabei als Einleitung in die Geschichte verstanden werden. Die beiden Gesellen werden zunächst vorgestellt. In den mittleren Strophen werden die Schicksale näher beschrieben, wobei Eichendorff zum ersten Gesellen nur eine Strophe schreibt, dem zweiten aber zwei Strophen widmet. Die vierte und fünfte Strophe handeln vom bewegten Leben des zweiten Gesellen. In der letzten Strophe meldet sich das lyrische-Ich zu Wort und gibt einen Kommentar ab, mit einem Appell am Ende (vgl. V. 30). Die letzte Strophe kann man als Gegenstück zur Ersten sehen, da hier nochmals die Motive des Frühlings (V. 5 und V. 27) und des Aufbruchs (vgl. V. 1) bzw. der Heimkehr (vgl. V. 30) angesprochen werden. So gesehen bekommt das Gedicht dann einen festen Rahmen, in dem sich die Geschichte der zwei Gesellen abspielt.
In der ersten Strophe wird das Motiv des Aufbruchs und des Neuanfangs durch die „hellen, klingenden, singenden Wellen“ (V. 4 f.) und durch das Symbol des Frühlings ausgedrückt. Die Wellen verleihen diesem Neuanfang zudem noch eine gewisse Dynamik, sodass sie „jubelnd“ (V. 3) von zuhaus‘ wegziehen können. Die erste Strophe (vgl. V. 1 - 5) beinhaltet den Beginn des Spazierganges beider Gesellen. Der Spaziergang symbolisiert den Aufbruch der Gesellen in die Welt (vgl. V. 1 ff.). Auffallend ist dabei besonders das Wort „Frühling“ (V. 5), welches äußerst positiv besetzt ist, indem er Freude, bunte Farben und Blüte impliziert. Folglich lässt sich feststellen, dass sich die jungen Gesellen in der „Blüte ihres Lebens“ befinden. Mit der Personifikation, der „hellen, klingenden, singenden Wellen“ (V. 3 f.) wird die Wirkung eines Neuanfangs erzeugt. Ebenso wird die Lebhaftigkeit der jungen Gesellen vermittelt. Diese Personifikation (vgl. V. 3 f.) lässt sich jedoch ebenfalls als Klimax herausstellen, welche den Beginn und das Voranschreiten der Reise umschreibt.
Die darauffolgende zweite Strophe (vgl. V. 6 - 10) beleuchtet die Zukunftsvisionen und Gefühle beider Gesellen. Der Wunsch nach Erlebnis wird deutlich. In der Strophe, die mit einer Anapher des Wortes „Die“ und einem sich wiederholendem Satzbau anfängt, werden erst zunächst die Ziele der Gesellen vorgestellt: Sie streben nach „hohen Dingen“ (V. 6), das heißt einem gewissen Ideal und haben auch Ansprüche (vgl. V. 7) an ihre Reise. Trotz alledem, wirken sie nicht so naiv, da ihnen auch der Schmerz bei dieser Reise bewusst ist (vgl. V. 7), doch sie wollen die Reise trotzdem wagen. Zudem kann man sagen, dass ihre Reise auf eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz stößt, da ihre Mitmenschen sich für sie freuen und mitlachen (vgl. V. 9 f.). Die zu Beginn verwendete Anapher des Wortes „Die“ (V. 6 f.) verdeutlicht ebenso, dass nicht nur die Gesellen selbst nach einem glücklichen Leben und Erlebnis streben, sondern dass dieses auch für viele andere gilt. Es findet sich eine Antithese (vgl. V. 7), welche die Spannung und den Zwiespalt im Hinblick auf die Erwartungen der Gesellen darstellt. So verkörpern die Begriffe „Lust und Schmerz“ (V. 7) menschliche Schwächen, welche bereits darauf hindeuten, dass sich Hindernisse und Stolpersteine im Leben der Gesellen ergeben werden.
Zusammenfassend lässt sich für die ersten beiden Strophen festhalten, dass eine sehr positive und optimistische Grundstimmung herrscht. Die Stimmung ist überschwänglich, den Gesellen scheint trotz der Möglichkeit auf Hindernisse alles möglich zu sein. Sie verfügen über den nötigen Willen und die Leidenschaft, etwas in ihrem Leben erreichen zu wollen.
In der dritten Strophe wird nun nur noch auf den ersten Gesellen eingegangen, der sein persönliches Ideal der Liebe umsetzen konnte (vgl. V. 11) und somit aus seiner Sicht Erfolg hatte, was zunächst als sehr positiv zu werten ist. Es wird beschrieben, wie der erste Geselle seine zukünftige Frau kennenlernt und mit ihr ein Kind zeugt und sich in einem ländlichen Haus niederlässt. Die Verse 12 bis 15 strahlen eine gewisse Unsicherheit aus, zudem wird sein Erfolg mit seiner Liebe durch die drei Diminutive (Verkleinerungsform) „Liebchen, Bübchen, Stübchen“ (V. 11, 13, 14) in mancher Hinsicht ins Lächerliche gezogen. Zudem konnte er sich sein Haus nicht selbst kaufen, sondern seine Schwiegereltern haben es bezahlt; auch dies ist weniger als Erfolg im klassischen Sinne zu verstehen. Somit haftet an seinem Erfolg der Liebe, doch eine Spur Sarkasmus, Lächerlichkeit und Unselbstständigkeit. Die Wellen aus der ersten Strophe sind hier nur noch beim Wiegen des Kindes vorzufinden (vgl. V. 13), somit fand auch hier eine Verschlechterung der Lage statt, da die Dynamik der ersten Strophe - durch die Wellen und die Aufbruchsstimmung - zum Teil verloren geht. Auch das Adjektiv „heimlich“ (V. 14) steht hier symbolisch für die Unsicherheit des ersten Gesellen. Die
Alliteration der Worte „Hof und Haus“ (V. 12) zeigen, dass der erste Geselle keine wirkliche Leistung erbracht habe, da sein Besitz durch seine „Schwieger“ (V. 12) geboten wird. Die verwendeten Adjektive und Verben, wie „heimlich“ (V. 14) oder „behaglich“ (V. 15) stellen den langweiligen Standard eines normalen bürgerlichen Lebens dar.
Sowohl die vierte als auch die fünfte Strophe handeln nun vom zweiten Gesellen, der im Gegensatz zum ersten zwar auch ein Schicksal hat, jedoch ein anderes. Er war naiv und fiel auf die „verlockend[en] Sirenen“ (V. 18) hinein, die hierbei für die Frauen bzw. die Erotik stehen.
Auch in der vierten Strophe gibt es eine Abwandlung der Wellen vom Anfang des Gedichts, und zwar in „buhlende(n) Wogen“ (V. 19), die in gewisser Weise etwas Bedrohliches an sich haben. In Vers 20 findet sich mit dem „farbig klingenden Schlund“ noch eine Synästhesie, die für die gestörte Sinneswahrnehmung des zweiten Gesellen steht. Der zweite Geselle ist von einem Laster geprägt, welches durch eine Allegorie (vgl. V. 16 f.) verdeutlicht wird. So „sangen und logen die tausend Stimmen im Grund“ (V. 16 f.), dies erzeugt eine mythische, beinahe märchenhafte Wirkung. Dies ist typisch für die Epoche der Romantik. Es wird deutlich, dass der zweite Geselle regelrecht dazu gerufen wird, sich seiner Lust hinzugeben und sich dieser nicht zu widersetzen versucht, geschweige denn, sich dieser widersetzen kann. Die Hyperbel der „tausend Stimmen“ (V. 17) zeigt, wie sehr an den zweiten Gesellen gezerrt wird. Das Symbol der „verlockenden Sirenen“ (V. 18), stellt das Risiko, welchem sich der zweite Geselle freiwillig aussetzt dar, obwohl die Sirenen ihn ausdrücklich auf die Gefahr hinweisen. Des Weiteren wird eine Synästhesie (vgl. V. 20) deutlich. Durch die Begründung eines „farbig klingenden Schlund“ (V. 20) wird noch einmal verdeutlicht, wie verlockend dieses Leben auf den zweiten Gesellen wirkt. Dieser lässt sich durch die vermeidliche Schönheit blenden und sich verführen. Das Motiv des Geheimnisvollen wird deutlich, welches ebenso für die Epoche der Romantik spricht.
Es lässt sich festhalten, dass beide Lebenswege der Gesellen sich gegen das Ideal eines sinnvollen Lebens des lyrischen Ichs aussprechen. Beide Gesellen erfüllen nicht die zuvor begründeten Erwartungen an ihr Leben, da sich der erste für ein Leben als Philister (kleinbürgerlich-engstirniger Mensch; Spießbürger) entscheidet und sich der zweite seinem Laster hingibt. So haben beide Gesellen keinen eigenen Erfolg erzielt, da sie beide ein bequemes, unausgeschöpftes Leben und damit ein Leben ohne Entwicklung wählten.
In der fünften Strophe wandelt sich noch einmal die Stimmung zu einer Tragödie: Der zweite Geselle wird nun als „müde und alt“ (V. 22) beschrieben, zudem war es still geworden und es weht ein kalter Wind (vgl. V. 24 f.). Diesen Wind könnte man mit dem Herbst assoziieren und dieser steht in dem Fall zusammen mit der neuen Beschreibung des Gesellen, für den Tod oder das Ende der Reise. Das Diminutiv (Verniedlichung) „Schifflein“ (V. 23) wirkt in dieser Strophe, im Unterschied zur Strophe drei, nicht lächerlich oder ironisch, sondern wirklich so, als sei dieses Ende des Gesellen bemitleidenswert und traurig.
Insgesamt findet sich in der gesamten Strophe eine Wassermetaphorik wieder, in welcher das Schiff für den Lebensweg des zweiten Gesellen steht (vgl. V. 21 ff.). Das Schiff ist am Meeresgrund gestrandet und symbolisiert damit, dass das Ende des Lebens des zweiten Gesellen erreicht ist und keine Möglichkeit mehr auf eine Weiterentwicklung besteht (vgl. V. 21 ff.). Auch das Leben des zweiten Gesellen entspricht nicht dem Ideal des lyrischen Ichs. Sein Leben und damit das „Schifflein“ (V. 23) verdeutlicht damit die Unbedeutsamkeit des kleinen Abenteuers des zweiten Gesellen. Auch sein erlangtes Lebensziel betrachtet das lyrische Ich nicht als etwas, worauf der Geselle stolz sein kann, wodurch es verniedlicht wird. Die traurige Atmosphäre wird durch die Verwendung der Adjektive „müde“ (V. 22), „alt“ (V. 22), „still“ (V. 24) und „kalt“ (V. 25) verstärkt. Der zweite Geselle wird als alt und zerbrechlich dargestellt, sein Leben scheint vorbei zu sein (vgl. V. 21 ff.).
Die zu Beginn gewählte romantische Sichtweise geht verloren, das Lebensziel wurde nicht erreicht. Der zweite Geselle erwacht aus seinem Erlebnisrausch und erkennt die traurige Realität (vgl. V. 21 ff.).
In der letzten Strophe werden die Wellen und der Frühling als Leitmotive erneut aufgegriffen (vgl. V. 26 f.) und nun folgt auch das erste Mal das Personalpronomen „mir“. Das lyrische Ich äußert sich nun selbst. Es ist entsetzt über die Lebensführung der beiden Gesellen. Die Gesellen werden als „keck(e)“ (V. 28) bezeichnet und nicht mehr als „rüst[i]g(e)“ (V. 1) Gesellen wie noch zum Beginn ihrer Reise. Die Tränen im Auge des lyrischen Ichs (V. 29) kann man als Trauer deuten, und zwar über das Schicksal beider Gesellen, auch über den ersten, was im ersten Augenblick vielleicht etwas außergewöhnlich erscheint, denn er hatte doch Erfolg mit seiner Liebe. Doch das lyrische-Ich sieht diesen Erfolg nicht wirklich, denn für ihn liegt der Erfolg bzw. der Sinn der Reise bei Gott (vgl. V. 30). Zuletzt findet sich der Appell „Ach Gott, führ uns liebreich zu dir!“ (V. 30) womit deutlich wird, dass das wahre Lebensziel des lyrischen Ichs in der Hinwendung zum Glauben liegt. Es ist kein Appell an die einzelnen Gesellen. Wie bereits erwähnt, wird im letzten Vers das erste und auch einzige Mal das Personalpronomen „uns“ benutzt. Somit wird deutlich, dass das lyrische Ich nicht nur die Gesellen anspricht, sondern jeden einzelnen Menschen.
In dem Gedicht „Die zwei Gesellen“ von Joseph von Eichendorff werden zwei unterschiedlich Schicksale behandelt. Der eine Geselle findet anscheinend die Liebe, die jedoch nicht nur so positiv gesehen wird, und der andere verliert sich, als er bei den Frauen seinen Erfolg und zusätzlich die Freiheit sucht. Die Intention des Autors liegt darin, dass der Leser nicht entscheiden soll, welches Schicksal das leichtere ist oder sich ein Vorbild nehmen soll, sondern der Leser soll für sich einen geeigneten Mittelweg finden. Die extreme Enge gegenüber dem Untergang - beides ist nicht erstrebenswert; schließlich sei die Einkehr und Rückkehr zu Gott das wahre Ziel der Reise. Das Leben ist nie perfekt, sondern durch Schicksalsschläge geprägt. Es ist wichtig, während der Reise sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und überhaupt ist kein Leben besser als das andere. Das Leben ist eine unkontrollierbare Reise, während der Tod das gewünschte endlose Ziel symbolisiert.
Dieses Video wurde auf YouTube veröffentlicht.
Folgende Referate könnten Dich ebenfalls interessieren:
Die nachfolgenden Dokumente passen thematisch zu dem von Dir aufgerufenen Referat:
- Eichendorff, Joseph von - Die zwei Gesellen (Gedichtanalyse)
- Eichendorff, Joseph von - Frühlingsfahrt Die zwei Gesellen (Gedichtinterpretation)
- Eichendorff, Joseph von - Die zwei Gesellen Frühlingsfahrt (Analyse)
- Eichendorff, Joseph von - Frühlingsfahrt (Gedichtinterpretation)
- Eichendorff, Joseph von - Mondnacht (Analyse Interpretation)
Freie Ausbildungsplätze in Deiner Region
besuche unsere Stellenbörse und finde mit uns Deinen Ausbildungsplatz
erfahre mehr und bewirb Dich direkt